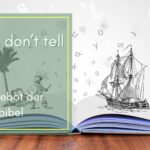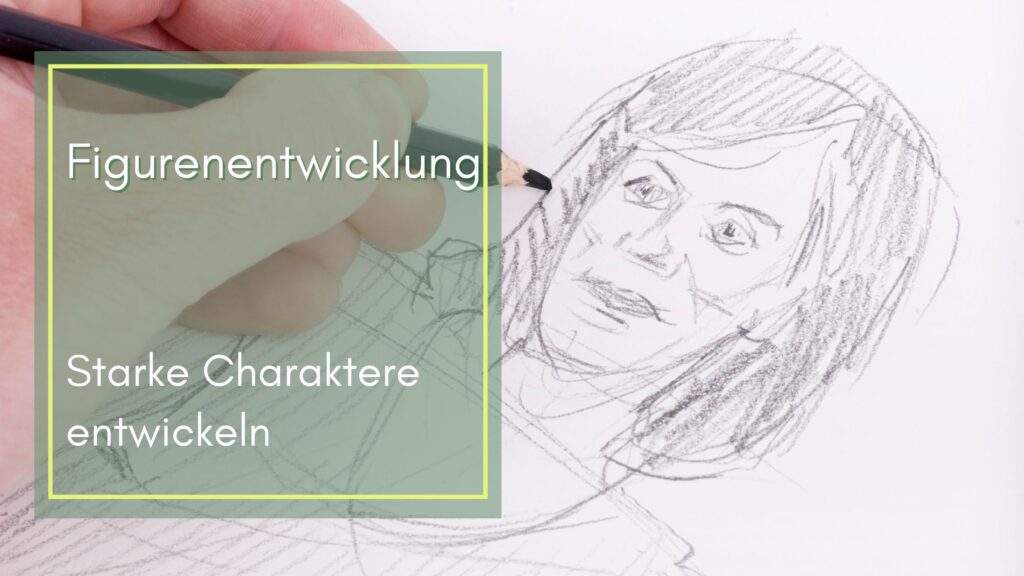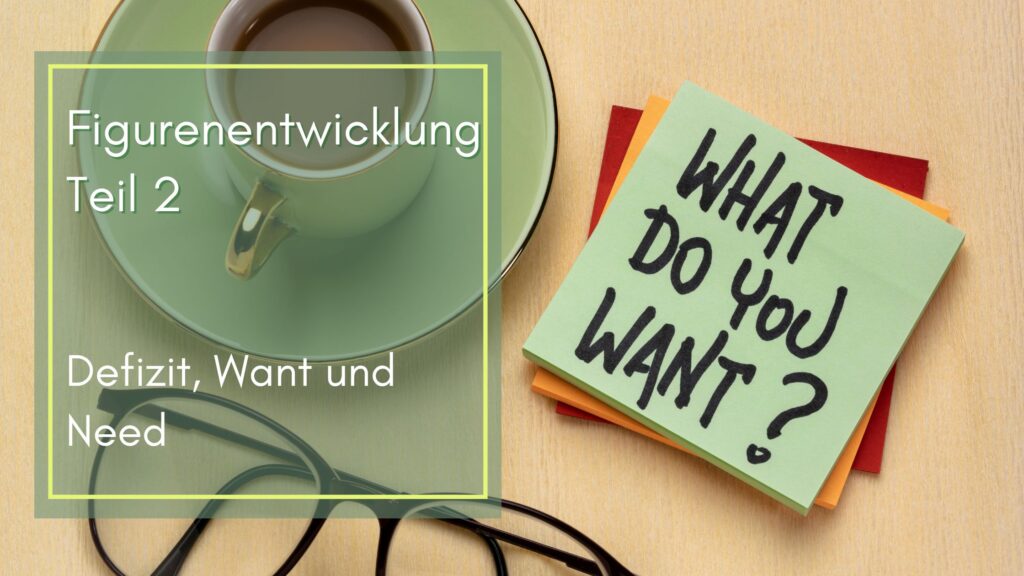Die Wahl der Erzählperspektive ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die du als Autor:in treffen kannst. Sie beeinflusst nicht nur die Nähe zu den Figuren, sondern auch, wie die Lesenden deine Geschichte erleben. Soll der Leser hautnah mit einer Figur mitfühlen? Oder möchtest du das gesamte Geschehen aus einer allumfassenden Sicht beleuchten? In diesem Beitrag zeige ich dir die Unterschiede zwischen dem allwissenden Erzähler, der Ich-Perspektive und dem personalen Erzähler. Außerdem erfährst du, welche Vor- und Nachteile diese Perspektiven haben, wie du sie sinnvoll einsetzt und welche Stolperfallen du vermeiden kannst.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist die Erzählperspektive?
- 1. Der allwissende Erzähler
- 2. Die Ich-Perspektive
- 3. Der personale Erzähler
- Gegenüberstellung am Textbeispiel
- Weitere, eher selten genutzte Erzählperspektiven
- Wer die Wahl hat …
- Fehlerquellen bei Perspektivwechseln – und wie du sie vermeidest
- Die Wirkung
- Mit Perspektiven spielen: Kreativität im Erzählen
Was ist die Erzählperspektive?
Eine Perspektive bezeichnet den Blickwinkel, aus dem eine Geschichte erzählt wird. Sie bestimmt, welche Figur die Handlung vermittelt und wie viel die Lesenden über die Ereignisse, Gedanken und Gefühle der Figuren erfahren. Die Perspektive beeinflusst damit maßgeblich die Wahrnehmung der Geschichte, die Nähe zu den Charakteren und die emotionale Tiefe, die beim Lesen entsteht.
Man kann sich die Perspektive wie eine Kamera vorstellen: Sie entscheidet, was ins Bild kommt, welchen Fokus es gibt und ob das Publikum einen engen Ausschnitt oder einen umfassenden Überblick erhält. Dabei gibt es unterschiedliche „Einstellungen“ oder Formen der Erzählperspektive, die jeweils ihre eigenen Besonderheiten und Wirkungen haben.
Zum Beispiel erlaubt die Ich-Perspektive, die Geschichte direkt durch die Augen einer Figur zu erleben. Sie ist subjektiv und stark von den Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken dieser Figur geprägt. Der personale Erzähler hingegen erzählt ebenfalls aus der Sicht einer oder mehrerer Figuren, bleibt aber in der dritten Person und ist dadurch etwas weniger unmittelbar. Der allwissende Erzähler bietet einen umfassenden Überblick über alle Figuren und Geschehnisse und kann sogar in die Vergangenheit, Zukunft oder die Gedanken mehrerer Charaktere gleichzeitig eintauchen.
Die Wahl der Perspektive ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Schreiben, da sie sowohl den Stil der Erzählung als auch die Verbindung der Lesenden zur Geschichte prägt. Sie kann Nähe schaffen, Spannung erzeugen oder den Überblick bewahren – je nachdem, welche Erzählperspektive gewählt wird und wie konsequent sie umgesetzt ist.
1. Der allwissende Erzähler
Der allwissende Erzähler ist besonders in der klassischen Literatur weitverbreitet. Aber auch in zeitgenössischen Texten findet er sich gelegentlich. Dieser Erzähler „weiß alles“: Er kennt die Gedanken, Gefühle und Hintergründe jeder Figur und kann sogar in die Zukunft schauen oder Kommentare zur Handlung abgeben. Er ist jedoch gleichzeitig distanziert. Dieser Erzähler wirkt wie eine zusätzliche Instanz zwischen der Geschichte und den Lesenden. Möchtest du dir die Kamera vorstellen, so sitzt diese auf einem entfernten und erhöhten Ort. Ein Adlerhorst vielleicht? Von hier hat unser Erzähler die perfekte Rundumsicht und lässt es sich nicht nehmen, das Gesehene zu kommentieren.
Vorteile:
- Kompletter Überblick: Der allwissende Erzähler erlaubt dir, alle Aspekte der Handlung, der Figuren und der Welt zu zeigen.
- Flexibilität: Du kannst zwischen den Perspektiven wechseln und gleichzeitig eine Metaebene einbauen, etwa durch Kommentare oder Reflexionen des Erzählers.
- Geeignet für epische Geschichten: Besonders bei komplexen, groß angelegten Geschichten wie historischen Romanen oder Fantasy-Epen kann der allwissende Erzähler helfen, den Überblick zu behalten.
Nachteile:
- Distanz: Leser:innen fühlen sich oft weniger emotional eingebunden, weil der Erzähler „über“ den Figuren steht.
- Veraltet wirkend: In der modernen Literatur wird der allwissende Erzähler selten genutzt, da Leser:innen eher persönliche, intime Perspektiven bevorzugen.
- Verwirrung durch unklare Wechsel: Wenn nicht deutlich wird, wann der Erzähler zwischen Figuren oder Ereignissen springt, kann das den Lesefluss stören.

2. Die Ich-Perspektive
Die Ich-Perspektive ist der intimste und persönlichste Weg, eine Geschichte zu erzählen. Alles wird aus der Sicht einer Figur geschildert: Wir erfahren nur, was diese Figur denkt, fühlt und wahrnimmt. Das macht diese Perspektive besonders kraftvoll und emotional. Stell dir eine Kamera im Kopf der Figur vor. Alles, was diese Figur sieht, denkt, fühlt … erfährt auch der Leser. Du schlüpfst quasi in deine Hauptfigur. Alles andere bleibt jedoch verschlossen, dadurch ist diese Perspektive auch sehr limitierend.
Vorteile:
- Unmittelbarkeit: Lesende fühlen sich, als wären sie direkt in der Haut der Figur.
- Starke Bindung: Die Ich-Perspektive schafft Nähe und ermöglicht es, eine Figur besonders intensiv auszuarbeiten.
- Subjektivität: Da alles durch die Augen einer Figur gesehen wird, kann die Wahrnehmung verzerrt oder unzuverlässig sein – das kann Spannung erzeugen.
Nachteile:
- Begrenzte Sichtweise: Lesende wissen nur, was die Erzählerfigur weiß. Das kann es schwer machen, komplexe Plots oder parallele Handlungsstränge zu erzählen.
- Anstrengend bei unsympathischen Figuren: Wenn Lesende die Erzählerfigur nicht mögen, kann die ganze Geschichte darunter leiden.
- Schwierig bei mehreren Perspektiven: Mehrere Ich-Erzähler in einem Buch erfordern eine sehr klare Kennzeichnung, damit die Lesenden nicht verwirrt werden.
Die Ich-Perspektive eignet sich besonders für Charakterstudien, psychologische Romane, Liebesgeschichten oder Coming-of-Age-Erzählungen. Sie ist auch genretypisch in Jugendromanen, New Adult und Thrillern, die eine starke Identifikation mit der Hauptfigur erfordern.

3. Der personale Erzähler
Der personale Erzähler ist der „Mittelweg“ zwischen Allwissendem und Ich-Erzähler. Die Geschichte wird aus der Sicht einer oder mehrerer Figuren erzählt, aber der Erzähler bleibt in der dritten Person („er/sie“). Hier sitzt die Kamera nicht im Kopf, sondern auf der Schulter der Figur.
Vorteile:
- Flexibilität: Du kannst mehrere Perspektivfiguren nutzen und so verschiedene Blickwinkel zeigen.
- Emotionaler Zugang: Lesende fühlen sich mit den Figuren verbunden.
- Moderne Anmutung: Der personale Erzähler ist die beliebteste Perspektive in der zeitgenössischen Literatur und daher leicht zugänglich. Allerdings wird sie in einigen Genres gerade vom Ich-Erzähler abgelöst.
Nachteile:
- Klare Trennung notwendig: Wenn du zwischen Perspektiven wechselst, müssen diese Wechsel deutlich markiert werden. Unsaubere Wechsel wirken chaotisch und können den Lesefluss stören.
- Gefahr der Überlagerung: Wenn zu viele Perspektiven genutzt werden, verliert man leicht den Überblick.
Der personale Erzähler passt zu den meisten Genres – von Krimi über Fantasy bis hin zu Romanen mit mehreren Protagonist:innen. Er ist eine gute Wahl, wenn du mehrere Figuren beleuchten möchtest, ohne die Intimität der Erzählung zu verlieren.

Gegenüberstellung am Textbeispiel
Ich habe einen kurzen Abschnitt aus einem meiner eigenen Werke gewählt, um anhand dessen die verschiedenen Perspektiven noch einmal zu verdeutlichen:
Das Original ist aus der Ich-Perspektive Präsens geschrieben:
Die Morgensonne kämpft sich durch die dichten Wolken, als ich meinen Mantel enger um mich schlinge und die Tür hinter mir ins Schloss fallen lasse. Mein Ziel ist der Central Park. Ich hoffe, dort Thea zu treffen, denn ich möchte meine Idee wegen der Gala mit ihr besprechen. Es sind nur ein paar U-Bahnstationen, aber in dieser Zeit dreht sich das Gedankenkarussell unaufhörlich.
Der Abend mit Steven ist mir noch lebhaft in Erinnerung und hat mich die halbe Nacht nicht schlafen lassen. Seine charmante Art, die entspannte Atmosphäre und das Gefühl, mich so geben zu können, wie ich bin. Steven hat es mir leicht gemacht, mich zu öffnen. In seiner Gegenwart habe ich mich wertgeschätzt und verstanden gefühlt. Der vergangene Abend hat Spuren hinterlassen, genauso wie der Sturz auf dem Eis und die Nähe zu Tom. Es ist, als hätten die beiden Männer unsichtbare Linien zu meinem Herzen gezogen – und ich stehe genau zwischen ihnen.
Mit einem personalen Erzähler im Präteritum:
Die Morgensonne kämpfte sich durch die dichten Wolken, als sie ihren Mantel enger um sich schlang und die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Ihr Ziel war der Central Park. Sie hoffte, dort Thea zu treffen, um ihre Idee bezüglich der Gala mit ihr zu besprechen. Es waren nur ein paar U-Bahnstationen, aber in dieser Zeit drehte sich das Gedankenkarussell unaufhörlich.
Der Abend mit Steven war ihr noch lebhaft in Erinnerung und hatte sie die halbe Nacht nicht schlafen lassen. Seine charmante Art, die entspannte Atmosphäre und das Gefühl, sich so geben zu können, wie sie war. Steven hatte es ihr leicht gemacht, sich zu öffnen. In seiner Gegenwart hatte sie sich wertgeschätzt und verstanden gefühlt. Der vergangene Abend hatte Spuren hinterlassen, genauso wie der Sturz auf dem Eis und die Nähe zu Tom. Es war, als hätten die beiden Männer unsichtbare Linien zu ihrem Herzen gezogen – und sie stand genau zwischen ihnen.
Das Präteritum ist im personalen Erzähler gängig. Trotzdem füge ich den Text auch im Präsens ein – als direkten Vergleich:
Die Morgensonne kämpft sich durch die dichten Wolken, als sie ihren Mantel enger um sich schlingt und die Tür hinter sich ins Schloss fallen lässt. Ihr Ziel ist der Central Park. Sie hofft, dort Thea zu treffen, um ihre Idee bezüglich der Gala mit ihr zu besprechen. Es sind nur ein paar U-Bahnstationen, aber in dieser Zeit dreht sich das Gedankenkarussell unaufhörlich.
Der Abend mit Steven ist ihr noch lebhaft in Erinnerung und hat sie die halbe Nacht nicht schlafen lassen. Seine charmante Art, die entspannte Atmosphäre und das Gefühl, sich so geben zu können, wie sie ist. Steven hat es ihr leicht gemacht, sich zu öffnen. In seiner Gegenwart hat sie sich wertgeschätzt und verstanden gefühlt. Der vergangene Abend hat Spuren hinterlassen, genauso wie der Sturz auf dem Eis und die Nähe zu Tom. Es ist, als hätten die beiden Männer unsichtbare Linien zu ihrem Herzen gezogen – und sie steht genau zwischen ihnen.
Mit dem allwissenden Erzähler:
Die Morgensonne kämpfte sich durch die dichten Wolken, als sie ihren Mantel enger um sich schlang und die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Ihr Ziel war der Central Park. Sie hoffte, dort Thea zu treffen, um ihre Idee bezüglich der Gala mit ihr zu besprechen. Es waren nur ein paar U-Bahnstationen, aber in dieser Zeit drehte sich ihr Gedankenkarussell unaufhörlich.
Der Abend mit Steven war ihr noch lebhaft in Erinnerung und hatte sie die halbe Nacht nicht schlafen lassen. Seine charmante Art, die entspannte Atmosphäre und das Gefühl, sich so geben zu können, wie sie war, hatte sie tief berührt. Steven hatte es ihr leicht gemacht, sich zu öffnen. In seiner Gegenwart fühlte sie sich wertgeschätzt und verstanden. Doch der vergangene Abend war nicht der einzige, der Spuren hinterlassen hatte. Der Sturz auf dem Eis und die Nähe zu Tom beschäftigten sie ebenso. Es war, als hätten die beiden Männer unsichtbare Linien zu ihrem Herzen gezogen – und sie stand genau zwischen ihnen.
Doch obwohl sie mit diesen Gefühlen konfrontiert war, hatte sie keine Ahnung, wie sich die Situation weiterentwickeln würde. Der Weg, den sie vor sich hatte, war noch unklar, genauso wie ihre Entscheidung zwischen den beiden Männern. Und obwohl sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, wusste sie, dass die kommenden Stunden noch viele Fragen aufwerfen würden.
Hier erkennst du den angefügten kommentierenden, ja sogar hellseherischen Teil. Der obige Text ist in diesem Beispiel sogar identisch mit der personalen Perspektive.
Weitere, eher selten genutzte Erzählperspektiven
Neben den 3 genannten Perspektiven gibt es weitere Spielformen. Insbesondere den neutralen Erzähler.
Der neutrale Erzähler beschreibt nur, was äußerlich sichtbar oder hörbar ist, ähnlich einer Kamera, die die Szene einfängt, ohne in die Gedanken oder Gefühle der Figuren einzutauchen.
Auch das erzählende Du kann interessant sein, auch wenn es tatsächlich sehr ungewohnt ist. Hier wird der Lesende direkt angesprochen. „Du gehst die dunkle Straße entlang, dein Herz klopft. Ein Geräusch hinter dir lässt dich zusammenzucken.“
Wer die Wahl hat …
Die Wahl der richtigen Erzählperspektive ist gar nicht so einfach, und am besten findest du sie, indem du verschiedene Ansätze ausprobierst. Es gibt kaum etwas Ärgerlicheres, als nach einer fertigen Rohfassung festzustellen, dass eine andere Perspektive viel besser funktioniert hätte – ich spreche da aus eigener Erfahrung! Mir ist es passiert, dass ich einen kompletten Roman von der personalen Erzählweise auf die Ich-Perspektive umarbeiten musste. Zudem hatte ich auch noch die Zeit vom Präteritum ins Präsens geändert. Es war ein mittleres Desaster, weil man bei so einem Unterfangen nicht nur sämtliche Personalpronomen, sondern auch jedes Verb verändern und anpassen muss.
Deshalb lohnt es sich, schon vor dem Schreiben darüber nachzudenken, welche Wirkung du erzielen möchtest. Frage dich: Soll die Erzählung intensiv und subjektiv sein, oder möchtest du eher aus einer gewissen Distanz berichten? Sieh dir andere Romane in deinem Genre an. Welche Perspektive wird hier häufig genutzt? Stichwort Lesererwartung! In Liebesromanen sind die Ich-Perspektive oder der personale Erzähler mit wechselnden Figuren beliebt.
Ein hilfreicher Tipp: Schreibe eine Szene deiner Geschichte einmal aus der Ich-Perspektive und dem personalen Erzähler. Die wenigsten werden wohl den allwissenden Erzähler wählen, aber probiere auch das gern aus. So bekommst du ein Gefühl dafür, wie unterschiedlich dieselbe Szene wirken kann. Probiere, wie es sich anfühlt, in die Gedankenwelt einer Figur einzutauchen, oder wie sich der Ton verändert, wenn der Erzähler mehr Abstand hält. Berücksichtige auch, in welcher Perspektive du dich ganz persönlich wohler fühlst – immerhin wird dich dein Schreibprojekt einige Monate begleiten. Dieses Experiment hilft dir, die Perspektive zu finden, die sich für deine Geschichte am besten anfühlt und ihre Stärken optimal zur Geltung bringt. So vermeidest du aufwendige Änderungen im Nachhinein – und sparst dir viel Zeit und Nerven!
Fehlerquellen bei Perspektivwechseln – und wie du sie vermeidest
Perspektivwechsel können ein großartiges Werkzeug sein, um verschiedene Facetten deiner Geschichte zu beleuchten. Sie erlauben, mehrere Figuren vielschichtig darzustellen und unterschiedliche Blickwinkel auf die Handlung einzubringen. Doch sie bergen auch Risiken, die den Lesefluss stören. Der Wechsel der Perspektive ist immer eine Unterbrechung. Sie reißt den Lesenden aus der Geschichte, weil er sich in eine neue Figur hineindenken und fühlen muss und je nachdem auch noch das Setting wechselt. Natürlich liebst du alle deine Figuren, aber stelle dir immer zuerst die Frage, ob die Figur so wichtig ist, dass sie eine eigene Perspektive braucht. Was würde ohne sie fehlen? Was kann nur diese Figur vermitteln, was die Hauptfigur nicht kann? Wie bereichert eine neue Perspektive die Geschichte? Im Folgenden findest du eine detaillierte Übersicht der häufigsten Fehler und Tipps, wie du sie vermeidest.
Unsaubere oder abrupt eingesetzte Wechsel
Ein häufiger Fehler ist es, mitten in einer Szene oder gar innerhalb eines Absatzes unvorbereitet die Perspektive zu wechseln. Solche „Sprünge“ irritieren, weil man plötzlich nicht mehr weiß, wessen Gedanken oder Gefühle gerade verfolgt werden. Dieser Effekt wird oft als störend empfunden, weil er die Verbindung zu den Figuren unterbricht.
Beispiel eines unsauberen Wechsels:
Tim fühlte sich ausgelaugt und wollte einfach nur nach Hause. Warum musste der Tag so anstrengend sein? Sophie beobachtete ihn aus der Ferne und dachte, dass er sehr müde aussah.
In einem Moment sind wir in Tims Kopf, im nächsten plötzlich in Sophies – ohne Vorwarnung oder erkennbare Trennung.
Perspektivwechsel funktionieren am besten, wenn sie logisch in den Text eingebaut und durch Kapitel oder Szenen voneinander getrennt werden. Ein Absatzwechsel mit Leerzeile signalisiert, dass die Perspektive sich ändert. Beachte auch hier die W-Fragen zum Szeneneinstieg. Wer? Wo? Wann? Es muss sofort klar sein, bei welcher Figur man jetzt ist. Durchgesetzt haben sich Kapitel mit abwechselnden Perspektiven. Gerade beim Ich-Erzähler eine sinnvolle Variante. Hier wird häufig der Name der Figur in die Kapitelüberschrift eingefügt.
Zu häufige Perspektivwechsel
Wenn Perspektivwechsel zu oft oder zu schnell hintereinander erfolgen, wirken sie chaotisch. Lesende brauchen Zeit, um sich in die Gedankenwelt einer Figur einzufühlen. Häufiges Springen lässt Figuren oft oberflächlich erscheinen, weil man keine Gelegenheit bekommt, tiefer in ihre Gefühls- und Gedankenwelt einzutauchen. Bei jedem Perspektivwechsel wird man aus der Geschichte gerissen. Setze sie also mit Bedacht und erzähle eine gewisse Zeit aus einer Perspektive, damit Lesende sich darin einfinden können. Sonst wirkt es wie der Werbeblock im Fernsehen – wer mag den schon?
Beispiel eines übertriebenen Wechsels:
Tim ärgerte sich über Sophie. Warum konnte sie ihn nicht einfach in Ruhe lassen?
Sophie hingegen fand, dass Tim überempfindlich war. Immerhin war sie nur ehrlich gewesen.
Karl, der neben ihnen saß, wünschte sich, dass der Streit endlich aufhören würde.
Tom verstand nicht, worum es überhaupt ging, und spielte mit seinem Handy.
In diesem Beispiel wird die Perspektive innerhalb weniger Zeilen mehrfach gewechselt, was anstrengend zu lesen ist, und dazu führt, dass keine der Figuren wirklich greifbar wird.
Überlege immer: Trägt eine neue Perspektive zu meiner Geschichte etwas bei? Ist sie wirklich notwendig?
Verwechslung der Perspektivfiguren
Ein Fehler, der sich recht häufig einschleicht: Die Perspektive bleibt nicht konsequent. Plötzlich schleichen sich Informationen oder Gedanken in die Erzählung, die die Perspektivfigur eigentlich nicht wissen kann.
Beispiel eines inkonsequenten Wechsels:
Sophie wusste, dass Tim sie nicht verstand. Er war immer so verschlossen. Dabei hatte Tim schon längst entschieden, ihr alles zu erklären – nur eben später.
Hier erleben wir die Szene aus Sophies Sicht, aber die Information, dass Tim sich entschieden hat, ihr später alles zu erklären, gehört zu seinem inneren Gedankenraum. Sophie kann das nicht wissen, weshalb die Erzählperspektive unklar wird.
Besser:
Sophie wusste, dass Tim sie nicht verstand. Er war immer so verschlossen. Sie konnte nur hoffen, dass er irgendwann bereit wäre, mit ihr zu sprechen.
Die Wirkung
Unsichere oder zu häufige Perspektivwechsel machen es schwer, sich in die Figuren hineinzuversetzen, und können den emotionalen Zugang erschweren. Lesende erwarten Klarheit und einen roten Faden – wenn dieser verloren geht, reißt es aus dem Lesefluss. Im schlimmsten Fall landet das Buch in der Ecke.
Wenn Perspektivwechsel hingegen sinnvoll eingesetzt und sauber getrennt werden, ermöglichen sie eine vielschichtige Erzählung. Lesende können die Handlung aus verschiedenen Blickwinkeln erleben, ohne den Überblick zu verlieren. Gleichzeitig ist ein Perspektivwechsel ein effektives Mittel, um Spannung aufzubauen. Während unser Held mit einer Hand über der Klippe hängt, schwenken wir zum Antagonisten oder jener Figur, die unserem Helden zu Hilfe eilen soll. Wird er/sie rechtzeitig auftauchen?
Mit Perspektiven spielen: Kreativität im Erzählen
Sobald du die Grundlagen der Erzählperspektiven verinnerlicht hast, kannst du beginnen, bewusst mit ihnen zu spielen. Zum Beispiel kannst du eine Szene auktorial einleiten, indem du einen allwissenden Blick über die Umgebung wirfst – ein Dorf, eine geschäftige Stadt oder eine stille Landschaft – und dann die Perspektive zu deiner Hauptfigur wechseln lassen.
Stell dir vor, du beginnst mit einer Vogelperspektive: „Die kleine Stadt lag ruhig unter der weißen Schneedecke, fahl schob sich die Morgensonne über die Bergkuppe. Rauch stieg aus Schornsteinen, und irgendwo bellte ein Hund.“ Dann zoomst du näher: „Am Fenster des blassblauen Hauses, das durchaus schon bessere Tage gesehen hatte, stand Raja, eine Hand an der dampfenden Tasse Tee, die andere gegen die kalte Scheibe gedrückt.“ Jetzt wechseln wir zu Raja: „Das Haus war still. Geradezu gespenstisch still. Beinahe konnte sie den Holzwürmern im Gebälk bei ihrem Frühstück zuhören. Vielleicht war es die Kälte, vielleicht auch die Erinnerung an den gestrigen Abend, die ihr eine Gänsehaut bescherte.“
Solche Übergänge schaffen nicht nur Atmosphäre, sondern verleihen deiner Geschichte eine besondere Dynamik und Tiefe – vorausgesetzt, die Wechsel sind klar und nachvollziehbar gestaltet.
Fragen zur Perspektivwahl? Melde dich gern. Gemeinsam bringen wir dein Projekt zum Strahlen.