Klären wir zuerst den Unterschied zwischen Szenen und Kapiteln. Kapitel sind in erster Linie Leseabschnitte für Lesende. Es sind die Stellen, an denen man gut eine Pause machen kann. Kapitel können eine oder mehrere Szenen umfassen.
Eine Szene dagegen ist die kleinste, abgeschlossene Handlungseinheit in einer Geschichte. Sie spielt sich an einem bestimmten Ort und in einem bestimmten Zeitabschnitt ab und zeigt ein zusammenhängendes Geschehen. Oft hat sie einen kleinen Höhe- oder Wendepunkt. Eine Szene endet meist dann, wenn Ort, Zeit oder Perspektive wechseln. Sie hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du in 7 Schritten Szenen schreibst, die deine Leser:innen fesseln.
Inhaltsverzeichnis
1. Jede Szene erfüllt einen Zweck
Wir haben sie alle, diese Lieblingsszenen. Deine Figur geht vielleicht in einen Buchladen, sieht sich um und du fängst die Atmosphäre ein. Du riechst das Papier und die Druckerschwärze. Am Ende kauft deine Figur ein Buch, verlässt den Laden und … im besten Fall taucht später eine Szene auf, in der sie dieses Buch liest. Aber bringt diese Szene deine Geschichte voran? Zeigt sie eine Charaktereigenschaft deiner Figur? Begegnet sie dort jemandem, der später noch wichtig wird? Findet sie in dem Buch einen entscheidenden Hinweis oder legst du eine falsche Spur aus?
Um herauszufinden, ob deine Szene einen Zweck erfüllt, kannst du dich fragen, ob die Geschichte auch ohne diese Szene funktioniert. Wenn nicht, versuche das zu ändern. Manchmal reicht schon ein winziges Detail, um der Szene Relevanz zu verleihen. Ein kleiner Konflikt, der die Figur von einer neuen Seite zeigt, eine unerwartete Begegnung, die zu einer relevanten Information führt …
2. Jede Szene braucht Konflikte
Du kennst es: Jede Szene braucht einen Konflikt. Ja und nein. Mit Konflikten ist nicht das große Drama gemeint und schon gar nicht der epische Endkampf, sondern jede Art von Widerstand, der eine Figur an ihrem Ziel hindert. Das kann ein Missverständnis sein, ein plötzlicher Wetterumschwung, ein verspäteter Zug, eine unwillige Nebenfigur. Konflikte bauen Spannung auf, auch wenn sie klein sind. Dein Held kann nicht in jeder Szene den Endgegner besiegen, aber du kannst immer eine kleine Schwierigkeit einbauen, die deine Figur fordert.
Und trotzdem meine ich, dass es Szenen geben darf, in denen kein Konflikt im klassischen Sinne vorhanden ist. Szenen, in denen eine Charaktereigenschaft gezeigt oder ein harmonisches Bild gemalt wird. Auch diese Szenen können wichtig sein, um einen Bruch in der folgenden Szene stärker wirken zu lassen. Manchmal brauchen Lesende auch eine kleine Pause zum Atemholen. Wenn ein Konflikt, ein Kampf, ein Drama auf das Nächste folgt, wirkt eine Geschichte schnell überladen und nicht nachvollziehbar. Achte bei ruhigen Szenen darauf, dass es nicht langatmig wird. Spiele mit Spannung und Entspannung.
3. Starte deine Szene mitten in der Handlung
Ja. Unbedingt! Die Aufmerksamkeitsspanne ist in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Bücher wie Die Buddenbrooks von Thomas Mann wären heute wohl Ladenhüter. Also fange nicht bei Adam und Eva an. Wirf deine Leser:innen mitten hinein in die Geschichte!
Ich habe neulich den Film The Thursday Murder Club gesehen und war anfänglich irritiert, weil die Figuren so handelten und sprachen, dass ich dachte, ich hätte einen vorigen Teil verpasst. Es wurde nicht lang und breit erklärt, was die Figuren in ihrem Club tun und welche Fälle sie gelöst haben. Stattdessen redeten sie einfach über einen vergangenen Fall. Dieser Fall war auch nicht weiter relevant. Es ging nur darum zu verstehen, dass dieser Club bereits seit Längerem aktiv ist und alte Mordfälle löst. Diese Irritation darf durchaus sein, und du darfst sie deinen Lesenden zumuten.
4. Deine Szene braucht ein Bühnenbild
Ich begegne immer wieder Manuskripten, in denen es „Talking Heads“ gibt – Köpfe, die miteinander reden, aber überhaupt nicht klar ist, wo sich die Figuren befinden und was sie vielleicht noch tun (außer zu reden). Das ist wirklich verwirrend. Als Leserin stecke ich halb im Kopf der Figur, halb davor. Nur sehe ich nichts von der Umgebung. Diese „Talking Heads“ haben leider nicht einmal einen Körper vorzuweisen – die Armen.
Stell dir deine Szene als Theaterstück vor. Am Anfang jeder Szene geht der Bühnenvorhang auf. Das Licht geht an. Du siehst das Bühnenbild. Und dann die Figur(en), die auf der Bühne stehen und etwas tun. Dieses Bühnenbild hilft sofort, sich zu orientieren und gleichzeitig Atmosphäre aufzubauen. Als Autor:in ist es deine Aufgabe, dieses Bild zu zeichnen.
Beantworte deshalb am Beginn jeder Szene die W-Fragen. Stelle klar, wer, wo und (falls nötig) auch wann die Handlung stattfindet.
5. Figuren handeln lassen
Ich sprach schon von den „Talking Heads“. Eine Variante sind Szenen, in denen Figuren nur reden, ohne zu handeln. Diese Szenen bestechen durch Dialoge mit vielen Redebegleitsätzen und abwechselnd erzählten Passagen. Leider nutzen sich Redebegleitsätze irgendwann ab. Die Erzählung wirkt mechanisch.
Frage dich stattdessen, was deine Figuren während des Gesprächs tun können, denn selten werden sie steif wie Brokkoli irgendwo stehen oder sitzen. Vielleicht schneiden sie nebenbei Gemüse, schieben den Kinderwagen, bearbeiten einen Holzblock oder tun, was immer sie eben nebenbei tun. Solche Handlungen bringen Lebendigkeit in den Text, zeigen Emotionen und reduzieren ermüdende Redebegleitsätze.
Statt „sagte Margot“ schiebt Margot sich eine Haarsträhne hinters Ohr oder macht einen Ölwechsel an ihrem Auto. Statt „antwortete Klaus“ darf er die Windeln wechseln oder sich am Bart zupfen. So werden deine Szenen plastisch und deine Figuren greifbar. Gleichzeitig zeigst du auch ganz viel Charakter, denn ein windelwechselnder Klaus sammelt doch gleich ein paar Sympathiepunkte und Margot zeigt ganz deutlich, dass sie zupacken kann.
6. Lebendige Szenen mit Show, don’t tell
Du kannst es vielleicht schon nicht mehr hören – Show, don’t tell. Aber es wertet deine Szene sofort auf. Wenn du eine Szene geschrieben hast, lies sie noch einmal und suche gezielt nach Adjektiven. Sie sind oft (nicht immer!) ein Zeichen für Tell. Beispiel: Statt „Sie war nervös“ schreibe „Ihre Hände zitterten, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte.“ Statt „Er war wütend“: „Er knallte die Tür zu und ballte die Fäuste.“ Solche Bilder ziehen Lesende unmittelbar in die Szene und machen sie emotional erfahrbar.
5 weitere Signalwörter, damit du eine Idee bekommst, wonach du suchen kannst:
- Die Frau war schön.
- Es war ein schöner Tag.
- Im Zimmer sah es chaotisch aus.
- Er war verliebt.
- Das Essen war ekelhaft.
7. Szenen organisch verbinden
Deine Szene soll organisch zur nächsten führen. So kannst du z. B. eine Frage offenlassen oder einen Cliffhanger einfügen.
Hast du einen Sprung in der Erzählung, müssen deine Leser:innen ihm folgen können. Wenn Person A an Ort B wollte, dann ist sie genau dort in der nächsten Szene (es sei denn, irgendetwas ist passiert, warum dieser Plan schiefging). Eins führt zum anderen. Stell es dir wie einen Turm aus Bauklötzchen vor. Du kannst auch nicht in der Mitte einfach einen Stein auslassen.
Sonderfälle sind Rückblenden und ein Wechsel der Perspektivfigur. Diese sollten gut überlegt sein, denn sie sorgen immer erst einmal für Irritation bei den Lesenden. Es kann aber durchaus spannend und daher lohnenswert sein, mit diesen Stilmitteln zu spielen.
Wenn du Unterstützung für dein Herzensprojekt suchst, melde dich gern. Ich freue mich auf deine Nachricht!
Deine



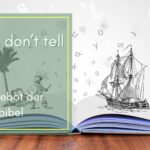

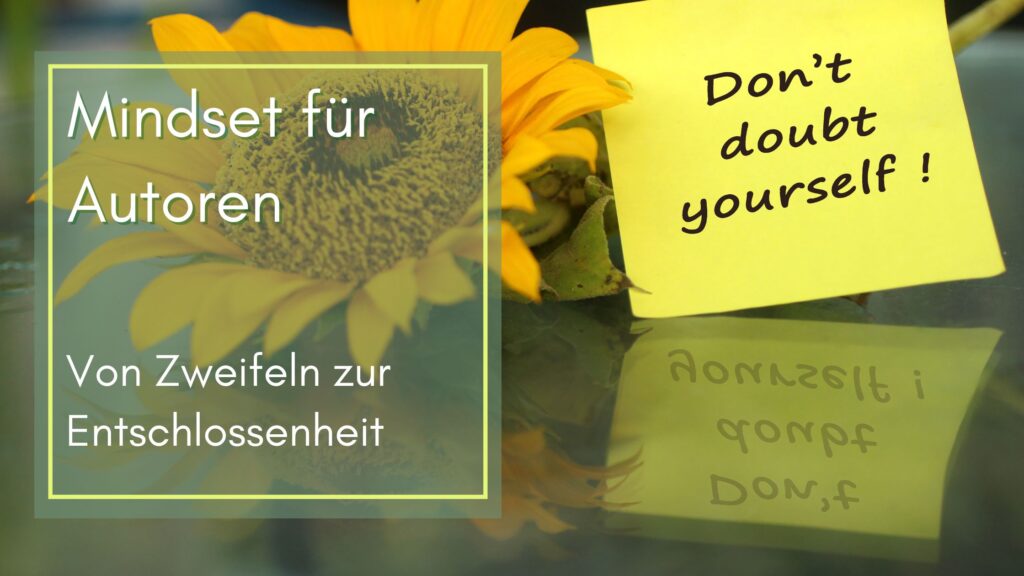
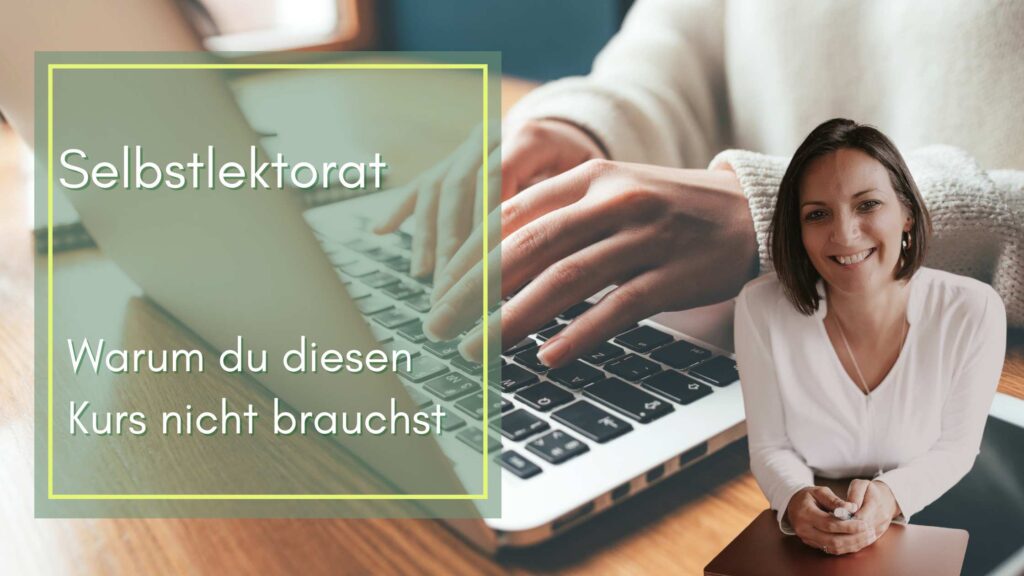
Pingback: KW38/2025: Alle TCS-Blogartikel - The Content Society