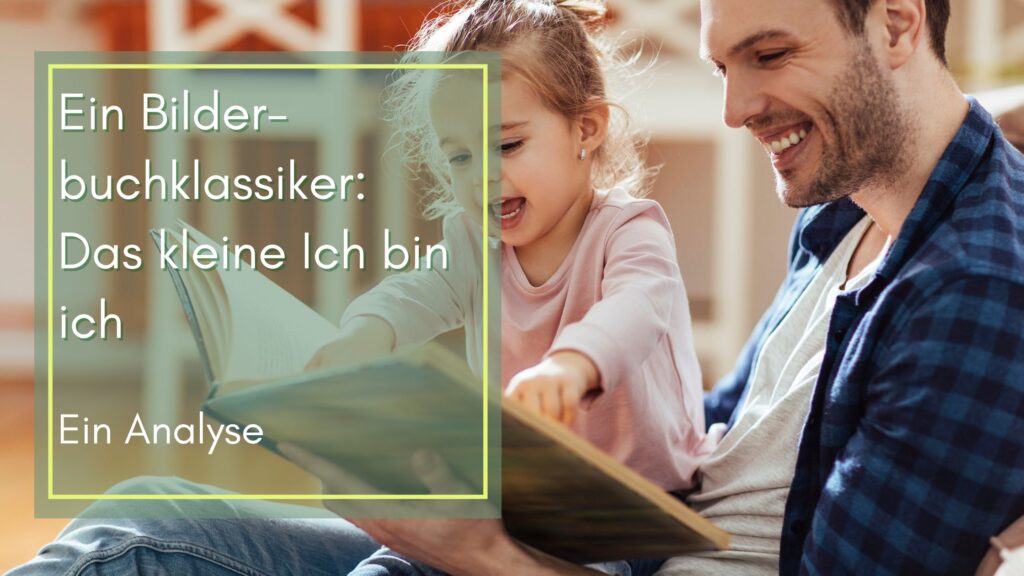Wenn man sich mit Jugendliteratur beschäftigt, kommt man an „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf kaum vorbei. Längst wird der Roman auch im Deutschunterricht behandelt. „Tschick“, 2010 bei Rowohlt erschienen, wurde mehrfach ausgezeichnet und 2016 verfilmt. Auf so vielen Ebenen zeigt dieser Jugendroman, wie gutes Erzählen für heranwachsende Leser:innen funktionieren kann. Ungekünstelt, bewegend, ehrlich. Ich habe das Buch im Rahmen einer Weiterbildung noch einmal mit dem Blick auf Sprache, Form und die besonderen Anforderungen von Jugendliteratur gelesen – und einiges mitgenommen, das ich gern teilen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist ein Jugendroman?
- Zwischen Tagebuch und Roadmovie – Die Form als Spiegel der Orientierungslosigkeit
- Authentizität ohne Anbiederung – Der Ton trifft ins Herz
- Sozialkritik zwischen den Zeilen
- Figuren, die Raum lassen – für Identifikation und Projektion
- Zwischen Rebellion und Selbstfindung – Die Reise als Metapher
- Was Schreibende von „Tschick“ lernen können
Was ist ein Jugendroman?
Doch zuerst werfen wir einen Blick auf die Definition. Was ist das überhaupt, ein Jugendroman?
Jugendromane erzählen Geschichten über das Erwachsenwerden – über erste große Gefühle, Unsicherheiten, das Ringen mit der eigenen Identität und den Wunsch, seinen Platz in der Welt zu finden. Die Hauptfiguren sind in der Regel zwischen 12 und 18 Jahren alt. Und genau diese Altersgruppe bildet auch die Zielgruppe. Stilistisch ist die Sprache oft nah an der Lebensrealität junger Leser:innen, ohne sich anzubiedern. Gute Jugendromane nehmen junge Menschen ernst – mit all ihren Fragen, Zweifeln und Träumen.
Innerhalb des Jugendromans gibt es zahlreiche Untergenres, die sich thematisch und stilistisch unterscheiden. Neben realistischen Jugendromanen, wie „Tschick“, die den Alltag, soziale Fragen oder persönliche Entwicklungsprozesse abbilden, finden sich auch fantastische Stoffe, Krimis, dystopische Erzählungen oder romantisch geprägte Geschichten – oft unter dem Label Young Adult. Letzteres richtet sich meist an etwas ältere Jugendliche ab etwa 16 Jahren und greift komplexere Themen wie Sexualität, gesellschaftliche Konflikte oder psychologische Entwicklungen auf. Wie so oft verwischen die Grenzen, aber trotz aller Unterschiede eint die Texte, dass sie jugendliche Lebenswelten aufgreifen und Räume öffnen, in denen junge Leser:innen sich wiederfinden – oder ganz neue Perspektiven entdecken können.
Zwischen Tagebuch und Roadmovie – Die Form als Spiegel der Orientierungslosigkeit
Auf den ersten Seiten fällt auf: Der Text wirkt fragmentarisch. Die Kapitel sind kurz, scheinen wie lose Tagebucheinträge. Momentaufnahmen, Gedankenfetzen. Man fragt sich, wann die Geschichte eigentlich losgehen soll und gerät dabei unmerklich in einen Sog. Dieser Anfang spiegelt Maiks innere Verfassung, seine Unsicherheit, die Leere, das Gefühl, irgendwie neben allem zu stehen. Brüchig und wenig stringent ist auch das Leben vieler Heranwachsender. Herrndorf schafft es, diese Unsicherheit nicht nur zu erzählen, sondern formal zu gestalten.
Authentizität ohne Anbiederung – Der Ton trifft ins Herz
Herrndorf trifft den Ton eines Fünfzehnjährigen so glaubwürdig, dass man als Leserin völlig vergisst, dass hier ein erwachsener Autor schreibt. Und doch: Er bedient sich keineswegs einer verkünstelten Jugendsprache, die bereits bei Erscheinen des Werkes überholt wäre. Stattdessen erzählt Maik in einem Stil, der direkt und ungeschönt ist, manchmal naiv, dann wieder überraschend reflektiert – so wie es eben ist, wenn man gerade dabei ist, die Welt zu begreifen.
Beim Schreiben für Jugendliche geht es nicht darum, „cool“ oder „authentisch“ zu klingen, sondern darum, ehrlich zu bleiben – im Ton, in der Perspektive, in der Haltung zur Figur.
Sozialkritik zwischen den Zeilen
Tschick erzählt von so vielem auf einmal: von Außenseitertum, von Familien, die nicht funktionieren, von heimlicher Liebe, von Vorurteilen, Freundschaft, Sexualität. Vieles bleibt unausgesprochen, wird angedeutet oder einfach nur gezeigt – und vor allem ohne erhobenen Zeigefinger.
So wird beispielsweise Tschicks Homosexualität in wenigen Sätzen angerissen. Der Protagonist Maik hinterfragt seine eigene Sexualität kurz, ist sich aber schon schnell im Klaren, dass Tschick nur ein Freund sein kann. Damit ist das Thema auch schon abgeschlossen. Kein großes Drama, keine Etikettierung – einfach eine Tatsache, die für Maik kurz irritierend ist, aber dann in seine Welt integriert wird. Ganz anders werden die aufkommenden Gefühle für Isa gezeigt. Zart, unsicher, fast schüchtern. Hier als sexuelles Erwachen zu deuten und auch wenn Isa kurz darauf Maik und Tschick verlässt, um ihre eigene Reise fortzusetzen, bleibt die Frage, ob Maik sich in Isa verliebt hat.
Und immer wieder blitzt Sozialkritik auf, in kleinen, ehrlichen Szenen. In der zerbrechenden Fassade der gutbürgerlichen Familie, im Kontrast zwischen Maiks und Tschicks Herkunft, Fremdenfeindlichkeit und in der Art, wie Erwachsene Verantwortung abschieben, in der Alkoholkrankheit von Maiks Mutter.
Figuren, die Raum lassen – für Identifikation und Projektion
Maik ist kein Held. Er ist unsicher, oft verloren – und genau deshalb so nahbar. Seine Perspektive wirkt glaubwürdig, auch weil sie nicht glatt ist: Er beobachtet, zweifelt, schweigt. Tschick hingegen bleibt lange ein Rätsel. Verschlossen, unberechenbar, immer ein wenig neben der Spur. Er kommt aus einem völlig anderen Umfeld als Maik, kämpft mit Vorurteilen, wird auf seine Herkunft reduziert und bleibt dennoch stark in seiner Eigenart. Beide Figuren tragen Probleme mit sich herum, die unter der Oberfläche brodeln – familiäre Konflikte, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit. Und nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint.
Gerade das macht sie als Figuren so stark: Sie lassen Raum. Raum für Identifikation, für Projektion, für Fragen. Für junge Leser:innen, die selbst irgendwo zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt stehen, sind solche Figuren ein Geschenk. Denn sie müssen nicht perfekt sein, um ernst genommen zu werden. Im Gegenteil. Es sind die Brüche, die Widersprüche, das Unausgesprochene, die sie lebendig machen. Tschick ist dafür ein wunderbares Beispiel. Zwei Jugendliche, die scheinbar wenig gemeinsam haben – und doch genau durch diese Verbindung wachsen.
Zwischen Rebellion und Selbstfindung – Die Reise als Metapher
Natürlich ist „Tschick“ auch ein klassischer Roadtrip. Die beiden Jungs sind nicht auf der Suche nach Ruhm oder Rebellion, sondern eher auf der Flucht: vor Erwartungen, vor Familien, vor sich selbst. Die Reise wird zu einem Raum, in dem alles möglich scheint. Begegnungen, Irrwege, kleine und große Prüfungen. Das alles passiert, ohne dass ein klares Ziel definiert ist.
Die Reise wird zur Metapher für das Erwachsenwerden. Für eine Zeit, in der alles im Umbruch ist: Werte, Beziehungen, Identität. Maik und Tschick testen Grenzen – moralische, soziale, persönliche. Sie überschreiten sie, hinterfragen und verschieben sie. Und genau wie im echten Leben ist das nicht immer geradlinig oder logisch. Es ist chaotisch, mutig, verletzlich.
In einer Welt, in der Erwachsene häufig über Regeln, Erwartungen und Lebenspläne definieren, bedeutet der Aufbruch ins Unbekannte auch, sich der eigenen Freiheit bewusst zu werden. Die Reise bietet ihnen einen Raum jenseits von Schule, Familie, Gesellschaft – in dem sie einfach nur sie selbst sein dürfen. Oder es zumindest versuchen.
Was Schreibende von „Tschick“ lernen können
Was du aus „Tschick“ mitnehmen kannst, ist vor allem eins: Vertrauen. Vertrauen in die Geschichte, in die Sprache, in die Figuren. Und Vertrauen in die jungen Leser:innen. Sie brauchen Texte, die sie ernst nehmen – mit all ihren Fragen, ihrem Chaos, ihrer Sehnsucht.
Wer also selbst für Jugendliche schreiben will, findet in „Tschick“ ein Buch, das zeigt, wie viel Tiefe und Leichtigkeit zugleich möglich sind. Und vielleicht auch ein bisschen Mut, eigene Wege zu gehen – auf dem Papier wie im echten Leben.
Du suchst Unterstützung bei deinem Herzensprojekt? Dann sichere dir ein kostenloses Probelektorat. Ich freue mich auf deine Nachricht.